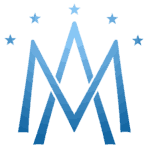Endlose Savanne, ewiger Sommer, einsame Strände.
Krankheit. Armut. Hunger.
Wenn man an Tansania denkt, schieben sich entweder traumhafte Bilder aus der Werbung oder aber die Albtraum-Nachrichten der Tagesschau vor das geistige Auge. Und tatsächlich: Wer als Tourist*in Serengeti und Sansibar einen Besuch abstattet, wird wohl in seiner paradiesischen Vorstellung bestätigt; wer die Situation auf den Dörfern mit „Entwicklungshilfe“-Blick scannt, wird in jedem Winkel Elend erkennen. Da wahrscheinlich keine der beiden Darstellungen meiner Lebenssituation in diesem Land entsprechen sollte, habe ich in der Vorbereitung auf mein eigenes Volontariat versucht, mich von möglichst vielen dieser Erwartungen zu lösen.
Von meinem Vorgänger erfuhr ich, dass ich theoretisch die Möglichkeit haben werde in der Krankenstation, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in den dazugehörigen Internaten oder in einer Gehörlosenschule zu arbeiten. (Oder mich, wie er, hauptsächlich handwerklich zu betätigen, was ich aber aufgrund meiner fehlenden Begabung, einen Hammer von einer Säge zu unterscheiden, bereits vorher ausschloss.) Dank dieses breiten Spektrums an möglichen Tätigkeitsbereichen wusste ich auch bezüglich meiner Arbeit noch nicht, was mich in den kommenden Monaten erwarten würde.
„Madam, snake in the toilet!“ – „Madam, Jovin is speaking mothertongue!“ – “Madam, sitaki kufuta!” – Wann auch immer ich das Klassenzimmer der Nursery-Class der Grundschule Milenia ya Tatu betrete, schallt mir das Wirrwarr der aufgeregten Stimmen zwanzig 4- bis 6-Jähriger entgegen. Die von Ordensschwestern geleitete Schule liegt in dem am Viktoria-See gelegenen Dorf, das ich nun für 10 Monate mein Zuhause nenne: Masonga. Drei Vormittage und fünf Nachmittage in der Woche verbringe ich mit diesen Kindern, den jüngsten der Schule. Doch in dem Alter, in dem ich meine Zeit noch am liebsten am Maltisch der Mäusegruppe verbrachte, wird hier von den Kindern einiges abverlangt. Nach dem Morgenappel geht es für die Klasse, Madam Immaculata und Madam Miriam nämlich nicht in einen Gruppenraum, sondern ins Klassenzimmer, und statt Mandalas gibt’s Mathehefte. Und das alles auf Englisch, was für die meisten hier neben der Stammessprache Luo und der Landessprache Kisuaheli die dritte Sprache ist.

Ich selbst erwische mich mittlerweile immer wieder dabei, dass ich auf die Frage, was ich am liebsten unterrichte, prompt mit „Numeras“ antworte. Dabei hatte ich Mathe doch nach dem Abi abgeschworen! Aber die Freude, dass ich jemandem schriftlich subtrahieren beibringen konnte, ist dann doch größer als die Frustration über meine gescheiterte Mathe-Karriere. Neben Rechnen lernen die Schüler*innen hier natürlich Lesen und Schreiben, haben aber auch Fächer wie „Environmental Care“ und „Relations“. Spiel und Spaß dürfen ebenfalls nicht zu kurz kommen. Deswegen ist es den Kindern, bevor es nach Hause geht, erlaubt, sich draußen auszutoben, während die Lehrkräfte im Lehrerzimmer Tee trinken. Offiziell zähle ich wohl auch eher zu den Lehrkräften, jedoch macht es mir mehr Spaß, draußen mit den Fingern in den Sand zu malen, zu klettern oder meinen Schatz an Singspielen auszupacken. Daran scheinen die Kinder Freude zu haben – ich werde mittlerweile schon von Einzelnen gefragt, ob wir am nächsten Tag mit ihrem Lieblingsspiel anfangen können und ob sie dann auch der Vormacher sein dürfen. So gibt es inzwischen täglich nacheinander Singspiele auf Englisch, Kisuaheli und Fantasiesprachen und zum Abschluss tanzen wir eine Runde Polka.
Oh und zu den Voraussetzungen, die eine Lehrkraft hier erfüllen sollte, gehören auch sehr resistente Finger. Da nämlich jedes Kind im Normalfall nur mit einem Bleistift ausgestattet in die Schule kommt und es im Klassenzimmer nur einen Spitzer gibt, ist man auch an dieser Stelle gefordert.
Leider bin ich in der Schule auch mit einigen Problemen konfrontiert. Wie reagiere ich, wenn die Lehrkräfte bei jeglichem Anlass beginnen, die Kinder zu schlagen? Wann, wo und mit wem ist es sinnvoll, über diese Disziplinarmaßnahmen zu diskutieren? Trage ich Schuld am schulischen Versagen der Kinder? Wie schaffe ich es, dass meine Schützlinge mich respektieren – auch, wenn ich die einzige Lehrerin bin, die nicht zuschlägt? Und: Mit wem kann ich hier über all diese Fragen und Gewissenskonflikte reden?
Einfacher wird es für mich da schon in der Gehörlosenschule Maalum, in der glücklicherweise ein viel geringerer Leistungsdruck herrscht und der Schlagstock meist einfach in der Ecke steht. Die Schule wird von ca. 15 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren besucht, die in vier unterschiedliche Klassen aufgeteilt sind, welche aber alle gemeinsam in einem Raum unterrichtet werden. Dienstags und mittwochs verbringe ich meine Vormittage hier und unterrichte die zweite Klasse im Lesen, Schreiben und Rechnen – in Gebärdensprache. Was ich mir als große Herausforderung vorgestellt habe, geht viel leichter als gedacht, da die Kinder mit ihrer Freude am Lernen meistens schnell begreifen, was ich von ihnen möchte, auch, wenn ich mich mit meinem bisherigen „Wortschatz“ an Gebärden vermutlich noch sehr unverständlich ausdrücke.

Nach den obligatorischen Unterrichtsstunden drehen wir deshalb häufig den Spieß um und ich werde zur Schülerin, die ursprünglich Lernenden zu Lehrenden der Swahili-Zeichensprache. Fürs Unterrichten hätten sie Spitzennoten verdient.
Egal ob es in Milenia ya Tatu, der Gehörlosenschule oder einfach auf der Straße ist: mit den Kindern verbringe ich hier am liebsten Zeit. Deswegen geht es hier für mich meistens nach dem Nachmittagsunterricht in das Internat der Grundschule, das von 80 Kindern besucht wird und aus einem Schlafsaal für die Jungs und einem für die Mädchen besteht. Der Rest spielt sich draußen ab. Dort versuchen die Fußball-Profis unter den Kids, ein wenig Talent aus mir heraus zu kitzeln, Musical-Choreografen zeigen mir die neuesten Dancemoves und mein persönliches Friseurteam verwandelt ein Tuch im Schatten der Bäume in einen Hair-Salon, nur für mich.

Zeit mit Gleichaltrigen verbringe ich einerseits mit den Mädchen der Secondary School, die ich jedes Wochenende im Internat besuche, und andererseits im Jugend-Chor der Kirche, dem ich bereits nach wenigen Tagen in Masonga beigetreten bin. Zu Beginn war es noch sehr schwierig, gleichzeitig ohne Noten in einer Sprache zu singen, die ich kaum verstehe, und dazu meine Tanzschritte zu koordinieren, aber mittlerweile klappt das dank der Geduld der anderen Chormitglieder, die die Bewegungsabläufe für mich immer nochmal in Zeitlupe wiederholten, immer besser. So kann ich die Gottesdienste mittlerweile im typisch ostafrikanischen Kleid inmitten lauter tanzender Sängerinnen und Sänger verbringen und falle nur durch meine Mzungu-Hautfarbe aus der Reihe. Neben Singen, Tanzen und Kisuaheli wurde mir im Chor außerdem beigebracht, dass Freundlichkeit zwar sehr groß, dafür aber Pünktlichkeit umso kleiner geschrieben wird. Im Chor lernte ich auch ein Paar kennen, die mich gleich auf ihre Hochzeit im Oktober einluden, bei der die Trauungszeremonie um acht Uhr morgens begann, das Brautkleid pink war und die Lautstärke des Jubels in der Kirche so manchen Fußball-Fanclub erblassen ließe. Darüber hinaus wurde unfassbar viel Konfetti geworfen und jedes Geschenk (Stoffe, Eimer, Ziegen, …) tanzend übergeben.

Ja, andere Länder, andere Sitten. Während ich mich an manche Dinge nur sehr ungern anpasste (Das Knicksen liegt mir einfach nicht), gewöhnte ich mich leicht daran, dass bei jeder Gelegenheit gesungen und getanzt wird, Gottesdienste manchmal ewig dauern und Bongo Flavour aus allen Radios klingt, dass die Wäsche mit den Händen gewaschen, über dem Feuer gekocht und Wasser auf dem Kopf getragen wird. (Hoffentlich bekomme ich das auch bald hin!)
Wer hierher kommt und ausschließlich auf Safari und Südseeluft aus ist, lernt das Land wohl nie richtig kennen; wer kommt und Tansania nur „weiterentwickeln“ möchte, dem wird die Möglichkeit entgehen, selbst etwas von den Menschen vor Ort zu lernen.
Nun muss ich also den Mittelweg finden.
Miri im Dezember 2019